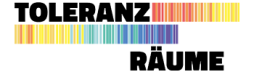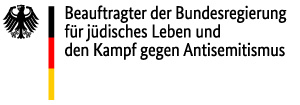Ein Trümmerhaufen,
der zum Himmel wächst
Die Filme "zum Mitnehmen"
„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Der Engel der Geschichte […] hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst.“
- Walter Benjamin
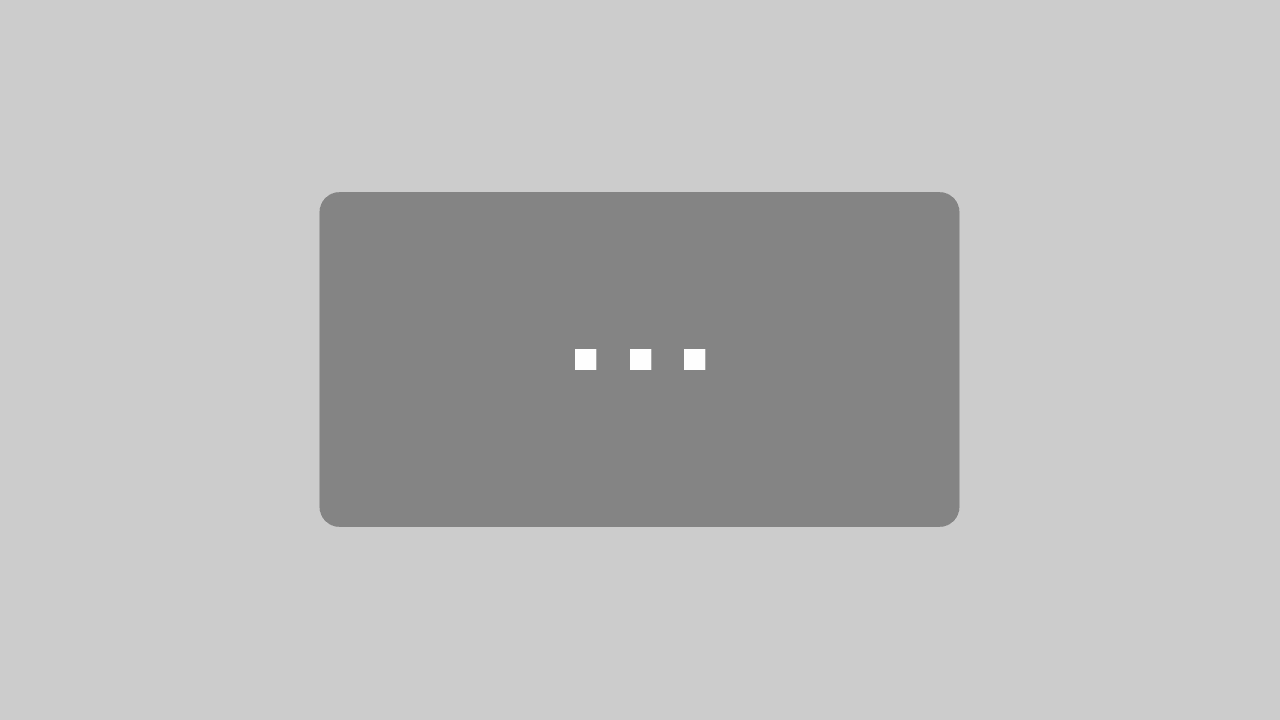
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
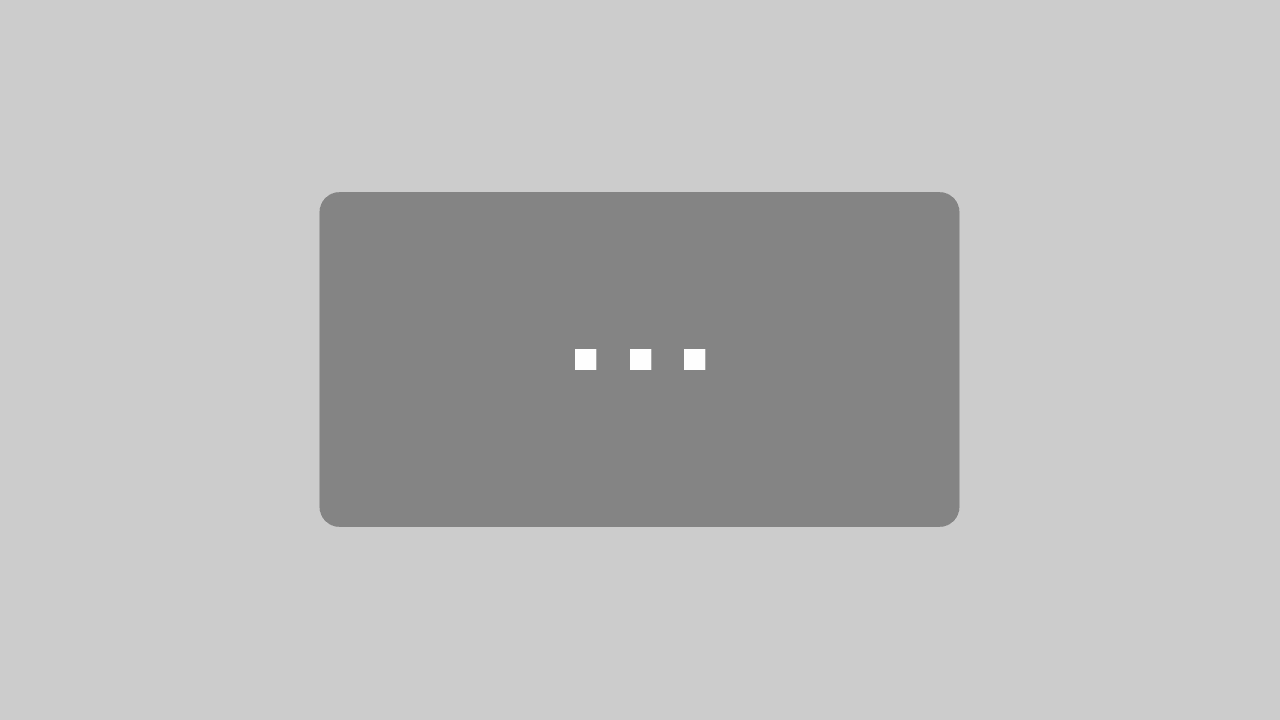
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
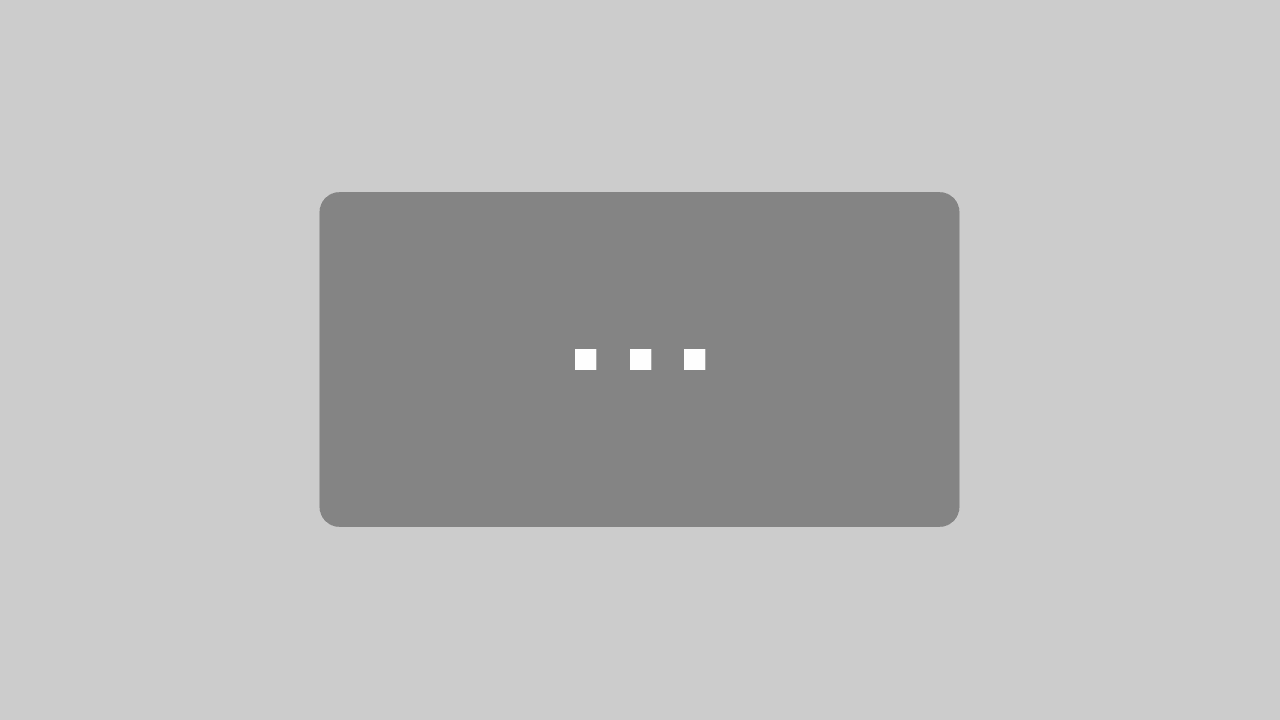
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
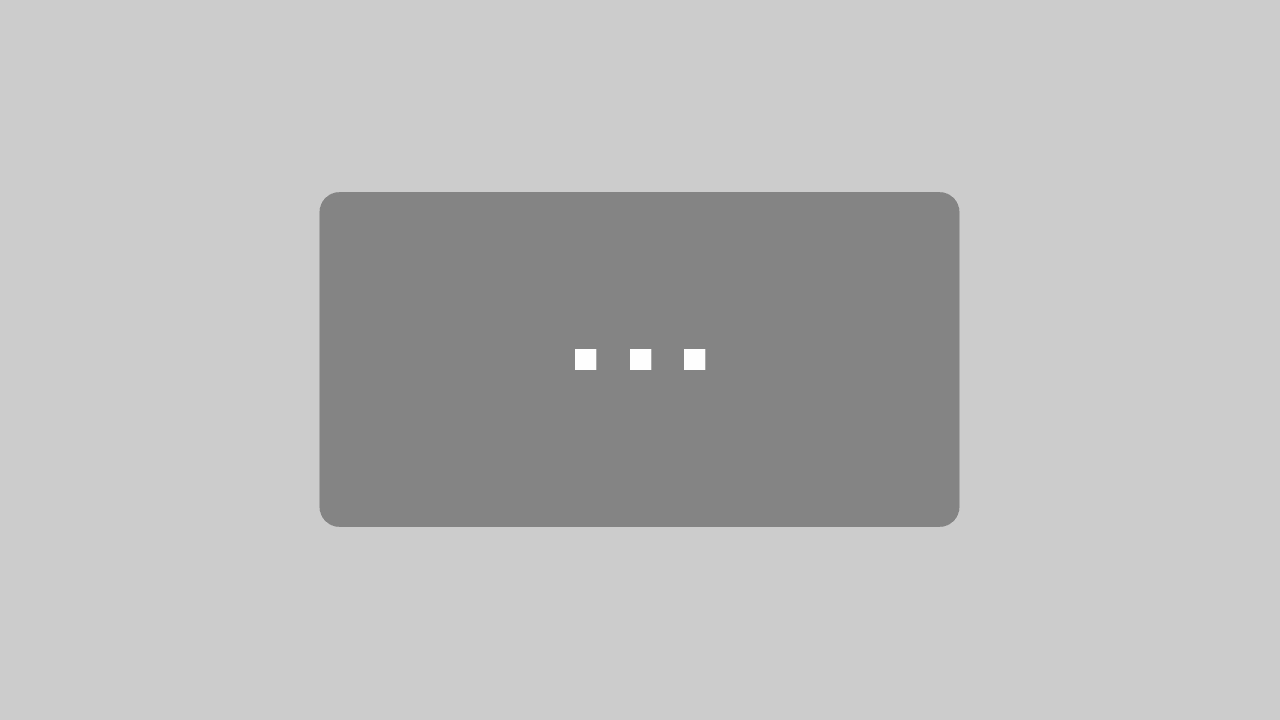
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
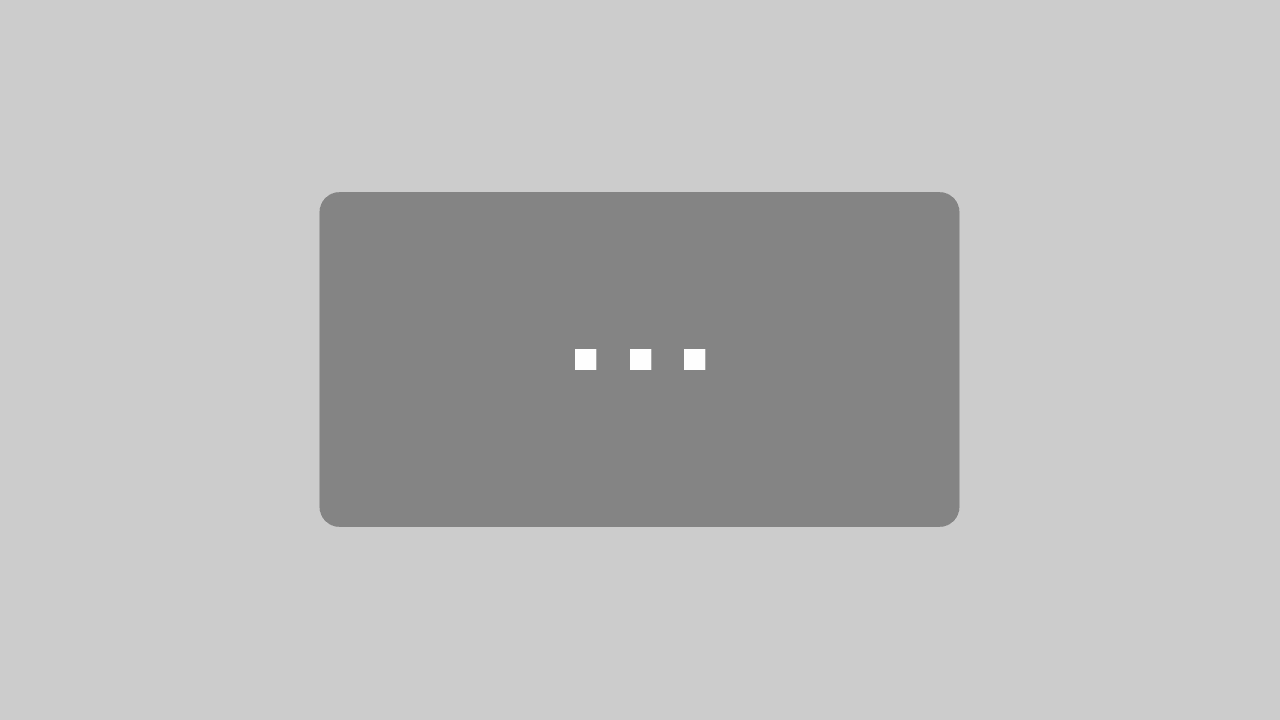
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Heritage Images / Fine Art Images / akg-images
Nur die massive Holztür verhinderte 2019 ein Massaker in der Synagoge von Halle
Am 9. Oktober 2019 zur Mittagszeit veröffentlichte ein deutscher Rechtsextremist auf verschiedenen Onlineplattformen ein Manifest. Es war voller hasserfüllter Sätze gegen Juden:Jüdinnen, Frauen und Einwanderer:innen. Danach begann er, seinen Hass in die Tat umzusetzen. Am höchsten jüdischen Feiertag – dem Versöhnungsfest Jom Kippur – verübte er einen Anschlag auf die jüdische Gemeinde von Halle. In der Synagoge feierten zu diesem Zeitpunkt 51 Menschen. Der 28-jährige Täter war mit selbstgebauten Schusswaffen und Sprengsätzen bewaffnet. Der Vorsteher der Synagoge sah den Täter über die Überwachungskamera der Synagoge. Er alarmierte die Polizei, sie war trotz des hohen Feiertags nicht vor Ort. Die Tür der Synagoge hielt den Schüssen des Attentäters stand. Nachdem er nicht eindringen konnte, ermordete er auf der Straße wahllos eine Passantin. Ihr Name war Jana Lange. Danach griff er einen nahegelegenen Dönerimbiss an, wo er einen weiteren Menschen tötete. Sein Name war Kevin Schwarze. Bevor er von der Polizei festgenommen werden konnte, hatte der Angreifer zwei Menschen erschossen und weitere verletzt. Die Überlebenden des Anschlags von Halle leiden bis heute unter den traumatischen Folgen.
Antisemitismus und Verschwörungsdenken haben mörderische Folgen
Der Anschlag von Halle hatte direkte Vorbilder. Der Täter von Halle übertrug seine Tat live ins Internet, wie am 15. März 2019 der rechtsradikal motivierte Massenmörder von Christchurch (Neuseeland). Auch seine Tat war bewusst geplant. In einem unmittelbar vor dem Anschlag veröffentlichten Manifest betonte er seine Absicht, „so viele Anti-Weiße zu töten wie möglich, vorzugsweise Juden“. Seine Äußerungen gehen zurück auf eine Idee der Neuen Rechten: den so genannten „Großen Austausch“. Anhänger dieser antisemitischen Verschwörungserzählung behaupten, die europäische Bevölkerung solle heimlich durch „Nicht-Weiße“ und insbesondere Muslime ersetzt werden. Dahinter stünden angeblich globale Eliten, die oft als Juden:Jüdinnen phantasiert werden. Derartiges Verschwörungsdenken setzen Attentäter wie der von Halle in Gewalttaten um, die sie als „Widerstandsaktionen“ verstehen. Rechte Verschwörungserzählungen sprechen jene Ängste an, die viele Menschen vor Zuwanderung und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen haben. Die Abschottung gegen Migration wird als angebliche „Lösung aller Probleme“ vorgestellt. Doch das Scheinbild einer rein „weißen“ Bevölkerung entspricht nicht der Wirklichkeit einer globalisierten Welt.
Schon die Nationalsozialisten haben die deutschen Juden:Jüdinnen ausgegrenzt und verfolgt mit einer Zwangsvorstellung von einer „reinrassigen deutschen Volksgemeinschaft“. Heute geht diese Diskriminierung im Denken vieler Menschen weiter. Auch von Vertreter:innen der AfD werden solche antisemitischen und rassistischen Ideen propagiert. Diese Ideologie aus Menschenverachtung und Intoleranz bedroht unsere Gesellschaft als Ganzes. Während des Prozesses gegen den Attentäter findet eine Überlebende aus der Synagoge dafür deutliche Worte:
„Bei dem Attentat hat es mich als Jüdin getroffen. Aber die vom Angeklagten repräsentierte Gesinnung trifft mich auch als Migrantin, als Frau und als Teil der deutschen Gesellschaft, die so vielfältig und divers ist, dass jede und jeder von uns zu irgendeiner Minderheit gehören kann, die unter Umständen für Benachteiligung markiert werden kann.“
Anastassia Pletoukhina, Nebenklägerin
Wir sind alle gemeint – Widerstandskräfte sind gefragt
Einige der Überlebenden waren im Prozess Nebenkläger:innen und berichteten darüber auf einem eigenen Blog. Der Anschlag hat bei den Betroffenen schwere Traumata hinterlassen. Ihr Gefühl, dass sie der antisemitischen Bedrohung hilflos ausgesetzt sind, wurde bei dem Anschlag stärker, weil trotz des Feiertags keine Polizei vor Ort war. Die Betroffenen haben auch deshalb den Schulterschluss mit Opfern und Angehörigen anderer rechtsterroristischer Anschläge gesucht. Diese gelebte Solidarität wurde unter anderem während des „Festival of Resilience“ (deutsch: Festival der Widerstandskräfte) sichtbar, das seit 2020 jährlich stattfindet. Überlebende der Anschläge von Halle und Hanau entzünden gemeinsam Gedenkkerzen für die Ermordeten beider Anschläge im Rahmen einer Zeremonie. Anlässlich des ersten Festivals sprach auch Faruk Arslan, der 1992 beim Brandanschlag von Mölln durch Neonazis seine Mutter, Tochter und Nichte verlor. Arslan verurteilte dabei scharf alle Versuche, die Täter als Einzelgänger oder geistig Verwirrte darzustellen:
„Sie denken, sie können uns kaputt machen. Nein, wir werden umso stärker. Wir werden uns niemals zurückziehen, wir werden immer wieder da sein und unsere Stimmen weitergeben.“
Faruk Arslan beim Festival of Resilience 2020
Nur die massive Holztür verhinderte 2019 ein Massaker in der Synagoge von Halle
Am 9. Oktober 2019 zur Mittagszeit veröffentlichte ein deutscher Rechtsextremist auf verschiedenen Onlineplattformen ein Manifest. Es war voller hasserfüllter Sätze gegen Juden:Jüdinnen, Frauen und Einwanderer:innen. Danach begann er, seinen Hass in die Tat umzusetzen. Am höchsten jüdischen Feiertag – dem Versöhnungsfest Jom Kippur – verübte er einen Anschlag auf die jüdische Gemeinde von Halle. In der Synagoge feierten zu diesem Zeitpunkt 51 Menschen. Der 28-jährige Täter war mit selbstgebauten Schusswaffen und Sprengsätzen bewaffnet. Der Vorsteher der Synagoge sah den Täter über die Überwachungskamera der Synagoge. Er alarmierte die Polizei, sie war trotz des hohen Feiertags nicht vor Ort. Die Tür der Synagoge hielt den Schüssen des Attentäters stand. Nachdem er nicht eindringen konnte, ermordete er auf der Straße wahllos eine Passantin. Ihr Name war Jana Lange. Danach griff er einen nahegelegenen Dönerimbiss an, wo er einen weiteren Menschen tötete. Sein Name war Kevin Schwarze. Bevor er von der Polizei festgenommen werden konnte, hatte der Angreifer zwei Menschen erschossen und weitere verletzt. Die Überlebenden des Anschlags von Halle leiden bis heute unter den traumatischen Folgen.
Antisemitismus und Verschwörungsdenken haben mörderische Folgen
Der Anschlag von Halle hatte direkte Vorbilder. Der Täter von Halle übertrug seine Tat live ins Internet, wie am 15. März 2019 der rechtsradikal motivierte Massenmörder von Christchurch (Neuseeland). Auch seine Tat war bewusst geplant. In einem unmittelbar vor dem Anschlag veröffentlichten Manifest betonte er seine Absicht, „so viele Anti-Weiße zu töten wie möglich, vorzugsweise Juden“. Seine Äußerungen gehen zurück auf eine Idee der Neuen Rechten: den so genannten „Großen Austausch“. Anhänger dieser antisemitischen Verschwörungserzählung behaupten, die europäische Bevölkerung solle heimlich durch „Nicht-Weiße“ und insbesondere Muslime ersetzt werden. Dahinter stünden angeblich globale Eliten, die oft als Juden:Jüdinnen phantasiert werden. Derartiges Verschwörungsdenken setzen Attentäter wie der von Halle in Gewalttaten um, die sie als „Widerstandsaktionen“ verstehen. Rechte Verschwörungserzählungen sprechen jene Ängste an, die viele Menschen vor Zuwanderung und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen haben. Die Abschottung gegen Migration wird als angebliche „Lösung aller Probleme“ vorgestellt. Doch das Scheinbild einer rein „weißen“ Bevölkerung entspricht nicht der Wirklichkeit einer globalisierten Welt.
Schon die Nationalsozialisten haben die deutschen Juden:Jüdinnen ausgegrenzt und verfolgt mit einer Zwangsvorstellung von einer „reinrassigen deutschen Volksgemeinschaft“. Heute geht diese Diskriminierung im Denken vieler Menschen weiter. Auch von Vertreter:innen der AfD werden solche antisemitischen und rassistischen Ideen propagiert. Diese Ideologie aus Menschenverachtung und Intoleranz bedroht unsere Gesellschaft als Ganzes. Während des Prozesses gegen den Attentäter findet eine Überlebende aus der Synagoge dafür deutliche Worte:
„Bei dem Attentat hat es mich als Jüdin getroffen. Aber die vom Angeklagten repräsentierte Gesinnung trifft mich auch als Migrantin, als Frau und als Teil der deutschen Gesellschaft, die so vielfältig und divers ist, dass jede und jeder von uns zu irgendeiner Minderheit gehören kann, die unter Umständen für Benachteiligung markiert werden kann.“
Anastassia Pletoukhina, Nebenklägerin
Wir sind alle gemeint – Widerstandskräfte sind gefragt
Einige der Überlebenden waren im Prozess Nebenkläger:innen und berichteten darüber auf einem eigenen Blog. Der Anschlag hat bei den Betroffenen schwere Traumata hinterlassen. Ihr Gefühl, dass sie der antisemitischen Bedrohung hilflos ausgesetzt sind, wurde bei dem Anschlag stärker, weil trotz des Feiertags keine Polizei vor Ort war. Die Betroffenen haben auch deshalb den Schulterschluss mit Opfern und Angehörigen anderer rechtsterroristischer Anschläge gesucht. Diese gelebte Solidarität wurde unter anderem während des „Festival of Resilience“ (deutsch: Festival der Widerstandskräfte) sichtbar, das seit 2020 jährlich stattfindet. Überlebende der Anschläge von Halle und Hanau entzünden gemeinsam Gedenkkerzen für die Ermordeten beider Anschläge im Rahmen einer Zeremonie. Anlässlich des ersten Festivals sprach auch Faruk Arslan, der 1992 beim Brandanschlag von Mölln durch Neonazis seine Mutter, Tochter und Nichte verlor. Arslan verurteilte dabei scharf alle Versuche, die Täter als Einzelgänger oder geistig Verwirrte darzustellen:
„Sie denken, sie können uns kaputt machen. Nein, wir werden umso stärker. Wir werden uns niemals zurückziehen, wir werden immer wieder da sein und unsere Stimmen weitergeben.“
Faruk Arslan beim Festival of Resilience 2020
„Kein 10. Opfer!“
Von 2000 bis 2006 ermordete die neonazistische Terrorvereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) deutschlandweit neun Menschen aus rassistischen Motiven: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat. Außerdem ermordete die Terrorzelle 2007 die Polizistin Michelle Kiesewetter. Zudem war der NSU seit 1999 für mindestens drei Sprengstoffanschläge mit vielen Verletzten und für mehrere Raubüberfälle verantwortlich.
Die Hinterbliebenen der Opfer gaben bereits früh Hinweise darauf, dass die Morde rechtsextrem motiviert gewesen sein könnten. Nach dem Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006 organisierten die Angehörigen von Enver Şimşek, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat zwei Demonstrationen in Kassel und Dortmund mit der Forderung: „Kein 10. Opfer!“ Doch diese Hinweise wurden von Staat und Behörden nicht ernst genommen.
Erst die Selbstenttarnung der dreiköpfigen Terrorzelle führte 2011 dazu, dass die bis dahin unaufgeklärten Morde und Anschläge von Staat und Behörden miteinander in Verbindung gebracht wurden. Von nun an war es nicht mehr möglich, das rassistische Motiv der Taten zu übergehen. Ebenso wenig war es noch möglich zu übersehen: die Terrorzelle wurde bei ihren Morden von einem rechtsextremen Netzwerk unterstützt.
Warum schauten Staat und Gesellschaft beim Rechtsterrorismus so lange weg?
Ermittelnde Behörden, Medien und Gesellschaft sprachen über die noch unaufgeklärten Morde lange Zeit mit der rassistischen Bezeichnung „Dönermorde“. Damit verortete man die Täter:innen im Umfeld der Opfer statt im rechten Milieu. Sie sprachen von „Parallelgesellschaften“ und organisierter Kriminalität. Weite Teile der Gesellschaft leugneten damit das rassistische Klima in Deutschland.
„Mein Vater wurde von Neonazis ermordet. Soll mich diese Erkenntnis nun beruhigen?“
Diese Frage stellte Semiya Şimşek-Demirtas beim zentralen Gedenken für die Opfer der Neonazi-Terrorzelle in Berlin 2012. Ihr Vater Enver Şimşek war am 9. September 2000 in Nürnberg durch die Rechtsterroristen ermordet worden. Die Behörden ermittelten über Jahre hinweg im Umfeld ihres Vaters. Man unterstellte dem Mordopfer, Drogendealer gewesen zu sein. Zwischenzeitlich war sogar ihre Mutter des Mordes verdächtigt worden. Dieser rassistische Ermittlungsansatz war ein Grund dafür, dass Semiya Şimşek-Demirtas und ihre Familie kaum Raum für eigene Trauer und Bewältigung ihres Verlusts hatten.
„Mein Vater wurde von Neonazis ermordet. Soll mich diese Erkenntnis nun beruhigen?“ fragte Semiya Şimşek-Demirtas 2012. Spätestens mit der Selbstenttarnung 2011 war allen das rechtsextreme Motiv der Morde klar. In Anbetracht des Fortbestehens der rechten NSU-Netzwerke kann diese Erkenntnis tatsächlich niemanden beruhigen. Wie waren solche Taten in Deutschland über Jahre hinweg möglich? Warum schauten Staat und Gesellschaft so lange weg? Warum mangelte es an Mitgefühl mit den Opfern? Wurden die Migrant:innen als „Deutsche zweiter Klasse“ betrachtet?
Lückenhafte Aufklärung und Verbindungen der Geheimdienste ins rechtsextreme Milieu
Kritische Jurist:innen, Journalist:innen und verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen deckten das Versagen der Behörden und Politik bei der Aufklärung auf. Das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz finanzierten im Umfeld der drei Terrorist:innen diverse Informant:innen aus der rechtsextremen Szene. Diese wiesen teilweise bereits ab 1998 auf ein Trio hin, das sich darauf vorbereitete, in den Untergrund zu gehen. Doch trotz zahlreicher Hinweise gelang es den Behörden von Bund und Ländern nicht, die Taten der Terrorist:innen zu verhindern.
Ab 2011 gab es Versuche der Aufklärung dieser Ermittlungsfehler durch Untersuchungsausschüsse und Gerichtsverfahren. Verschiedene Behörden behinderten das. Am 11. November 2011, unmittelbar nach der Selbstenttarnung des NSU, vernichteten Mitarbeiter:innen des Verfassungsschutzes Akten über mögliche NSU-Helfer:innen. Ein Mitarbeiter des Bundesamtes erklärte 2014, dass Akten vernichtet wurden, damit sie im Zuge der versuchten Aufklärung nicht mehr geprüft werden könnten. Dieses Eingeständnis hatte keinerlei Konsequenzen.
Die verschiedenen Ämter für Verfassungsschutz zogen den Quellenschutz ihrer Informant:innen einer vollumfänglichen Aufklärung der Anschläge des NSU vor. Diese Verschleierungstaktik wirft die Frage auf, inwieweit die Verfassungsschützer:innen in den NSU-Komplex verstrickt sind bzw. ihre eigene Verstrickung zu verbergen versuchen.
Viele Fragen bleiben bis heute ungeklärt, z.B. nach der Entstehung des NSU, nach den Unterstützer:innen und nach dem Wissen und der Rolle der Behörden. Nur eine lückenlose Aufklärung wäre geeignet, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich derartige Taten und Ermittlungsfehler wiederholen. Das Unterstützer:innennetzwerk des NSU bleibt so bestehen und stellt damit weiterhin eine Bedrohung dar. Eine Gruppe deutscher Rechtsextremisten versandte ab August 2018 mehr als 140 Morddrohungen. Mit der Unterschrift „NSU 2.0“ beziehen sie sich auf die rassistischen NSU-Morde.
Ein Pogrom mit Ankündigung
Im Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen war die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber:innen untergebracht. Im angrenzenden Nachbarhaus befanden sich Wohnungen vietnamesischer Vertragsarbeiter:innen. Als zwischen dem 22. und 26. August 1992 ein rechter Mob das Haus immer wieder angriff und schließlich in Brand setzte, klatschten und jubelten umstehende Bürger:innen.
Schon in den Wochen vor dem Pogrom hatten sich Anwohner:innen bei der Stadt Rostock und der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern über die angeblich nicht zu tolerierenden Zustände rund um die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) beschwert. Das Sonnenblumenhaus war überfüllt. Das Innenministerium verweigerte die Aufnahme weiterer obdachloser Asylbewerber:innen, in der Mehrheit Rom:nja aus Rumänien. Während die Menschen tagelang auf ihre Registrierung warteten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf der Wiese vor dem Haus zu übernachten. Die Stadt Rostock stellte ihnen nicht einmal mobile Toiletten bereit. Die Folge: Viele Anwohner:innen machten die Asylbewerber:innen zu Unrecht für diese Zustände verantwortlich.
Rechte Populist:innen befeuerten den vorhandenen Rassismus und nutzten Rostock als Bühne. Das mediale Interesse wuchs. Lokale Zeitungen reproduzierten unkritisch die Meinungen der Anwohner:innen sowie Aufrufe zur „Selbstjustiz“. Gewaltankündigungen der Rechten wurden weiterverbreitet.
Pogromstimmung grassiert und die Stadtgesellschaft lässt den Mob gewähren
Das Pogrom begann am Samstag, den 22. August. 1000 bis 2000 Menschen versammelten sich am ersten Tag rund um das Sonnenblumenhaus. Vor allem Jugendliche und junge Männer schossen Leuchtraketen ab und bewarfen das Haus unter jubelndem Beifall mit Steinen und Brandsätzen. Trotz der Gewaltankündigung war die Polizei mit viel zu wenig Personal vor Ort und wurde selbst zur Zielscheibe des wütenden Mobs. Zeitweise zog sie sich ganz von dem Schauplatz des Pogroms zurück und überließ die Bewohner:innen des Sonnenblumenhauses sich selbst. So warfen die rechten Gewalttäter – darunter viele aus der Nachbarschaft – ungehindert Scheiben ein. Das Haus wurde regelrecht belagert. Ein Feuer brach aus.
Ab Sonntag, den 23. August mobilisierte die Neonazi- und Skinheadszene nochmal verstärkt ihre Anhänger, nach Rostock zu kommen. Der Gewaltexzess nahm zunehmend einen „Volksfest-Charakter“ an. Auch am Sonntagnachmittag versammelte sich die Lichtenhagener Nachbarschaft wieder um das Haus. Am Montagnachmittag, den 24. August, verlegte die Landesregierung endlich die Asylbewerber:innen. Daraufhin griffen die Rechten den angrenzenden Gebäudetrakt an, in dem seit 15 Jahren Vertragsarbeiter:innen aus Vietnam lebten.
Die politisch Verantwortlichen versagen
Während der tagelangen Ausschreitungen übernahmen weder die Polizei noch die Stadt oder die Landesregierung die Verantwortung, sich um den Schutz der bedrohten Menschen zu kümmern und das Pogrom zu beenden. Bis Montag gelang es der Polizei nicht, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Bis heute ist unklar, was Bundesinnenminister Seiters, Ministerpräsident Seite, Landesinnenminister Kupfer und Teile der Landespolizeiführung an diesem Vormittag in einem vertraulichen Gespräch miteinander berieten. Der ZDF-Journalist Jochen Schmidt geriet mit seinem Dreh-Team am Montag
im Sonnenblumenhaus durch das Feuer selbst in Lebensgefahr. In seinem detaillierten Bericht legte er die Vermutung nahe, die politisch Verantwortlichen in Bund und Land hätten absichtlich eine Eskalation zugelassen, um die politische Debatte in Richtung einer Verschärfung des Asylrechts zu beeinflussen.
Rettung über das Dach
Obwohl die Angriffe ihren Höhepunkt erreichten, zog sich die Polizei am Montag gegen 21 Uhr zurück. Minuten später brach das Feuer aus. Die Feuerwehr wurde gerufen, konnte aber nicht löschen, weil Angreifer:innen und Schaulustige den Weg versperrten. Während die Menge draußen Naziparolen grölte, wurde die Situation für die 120 Menschen im Haus durch die Rauchentwicklung lebensbedrohlich. Die Vietnames:innen, der Wachmann, einige Helfer:innen und das Fernsehteam suchten nach einem Fluchtweg. Über eine aufgebrochene Notausgangstür gelangten sie ins ebenfalls brennende Nachbargebäude und von dort aus aufs Dach, während bewaffnete Rechte von unten das Haus stürmten. Der Ausländerbeauftragte der Stadt, Wolfgang Richter, ebenfalls ein Augenzeuge, erinnerte sich an den Blick vom Dach: „Mehrere Tausend Leute, die gegrölt und geklatscht und gejubelt haben, Erwachsene […] die […] die Jugendlichen immer wieder angefeuert und angetrieben haben […]. Und wir […] waren irgendwie fassungslos, dass das passieren kann“.
Das politische Erbe des Pogroms wirkt fort
Am selben Tag rechtfertigte Ministerpräsident Berndt Seite das Verhalten der Gewalttäter:innen bei einer Pressekonferenz mit dem Bundesinnenminister. Den Opfern des Pogroms wurde keinerlei Entschädigung zugesprochen. Die Anwohner:innen erhielten dagegen einen Monat lang mietfrei, während viele der Vietnames:innen weiter um ihr Bleiberecht kämpfen mussten. Die Rom:nja wurden abgeschoben. 1993 wurde das Recht auf Asyl durch eine Grundgesetzänderung eingeschränkt. Schon in den Jahren zuvor hatten deutsche Medien auf ihren Titelblättern einen „das Boot ist voll“-Diskurs befeuert. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen war zugleich Ausdruck und Beschleuniger dieser rassistisch aufgeladenenDebatte um Migration. Mit der Änderung des Asylrechts hatten Rechte und Rechtspopulist:innen ihr Ziel erreicht. Allein in der Woche nach dem Pogrom kam es in Mecklenburg-Vorpommern zu fünf weiteren Angriffen auf Asylbewerber:innenheime. Nur wenige Gewalttäter:innen aus Lichtenhagen kamen vor Gericht – und wenn, erhielten sie nur milde Strafen. Rechte fühlten sich durch die Reaktion von Schaulustigen, Politik und Strafverfolgungsbehörden regelrecht ermutigt. Die folgenden Jahre waren geprägt von weiteren Brandanschlägen, Gewalttaten und Morden.
Stimmen der Betroffenen
Lange Zeit gab es wenig mediales Interesse an den Betroffenen. Romeo Tiberiade, der 1992 mit seiner Frau und seinen Kindern im Heim wohnte und der heute Berater eines rumänischen Bürgermeisters ist, erinnert sich 2022: „Viele Familien wurden auf dem Weg nach draußen durch das Feuer getrennt, das war beängstigend. Als wir draußen waren, wurden wir weiter mit Steinen und Brandflaschen beworfen. Einem Teil der Polizei war es offenbar egal, denn sie taten nichts. Und dann kamen auch noch die Journalisten und machten Fotos von uns. Sie haben meine Frau und unsere Kinder mit nackten Füßen fotografiert, weil wir nur mit dem geflohen sind, was wir am Leib hatten.“
Nguyen Do Thinh, der damals im Haus nur knapp dem Tod entkam, danach den deutsch-vietnamesischen Freundschaftsverein Diên Hông gründete und in Schulen über das Pogrom informiert, beklagt das anhaltende Desinteresse an der Geschichte der Betroffenen. Und er beobachtet dabei mit Entsetzen, dass die Gewalttäter:innen von Jugendlichen teilweise zu Märtyrer:innen verklärt werden.
Widerspruch von Nazi-Verfolgten
Eine Gruppe französischer Juden:Jüdinnen um Beate und Serge Klarsfeld reiste bereits am 19. Oktober 1992 nach Rostock, um gegen die Abschiebung der Rom:nja aus Lichtenhagen zu protestieren. Als „Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich“ drückten sie ihre Solidarität aus und brachten gemeinsam mit Rom:nja-Aktivist:innen eine Tafel am Rostocker Rathaus an. Diese Tafel erinnerte sowohl an das Pogrom in Lichtenhagen 1992 wie auch an die Ermordung von Sinti:zze und Rom:nja in Auschwitz 1944. Bei der Gedenkaktion kam es zu Tumulten. Mehrere Personen aus der Gruppe wurden durch die Rostocker Polizei verhaftet und die Tafel durch die Stadt entfernt.
Massaker in Distomo am 10. Juni 1944
Nahe der griechischen Ortschaft Distomo setzte die Wehrmacht 1944 eine Kompanie des SS-Polizei-Panzergrenadier-Regiments 7 ein, die bereits zuvor Zivilist:innen ermordet hatte. Sie durchsuchte am 10. Juni 1944 erfolglos Distomo nach Partisan:innen. Eine Kolonne brach von Distomo in Richtung Stiri auf. Sie wurde unterwegs von Partisan:innen angegriffen. Drei deutsche Soldaten kamen bei der folgenden Schießerei ums Leben. Als Reaktion verübten die Deutschen in Distomo unter unbeteiligten Dorfbewohner:innen ein grausames Massaker.
Sie durchkämmten die Häuser, töteten die Menschen, legten Feuer und erschossen das Vieh. 218 Menschen fielen der Racheaktion zum Opfer, darunter Säuglinge, Schwangere und alte Menschen.
Distomo ist einer von vielen Tatorten in Europa: Allein in Griechenland wurden von den Deutschen ungefähr 1500 Dörfer zerstört und zigtausende Geiseln und Zivilist:innen hingerichtet. Ungefähr 60.000 Juden:Jüdinnen wurden in der Schoah aus Griechenland deportiert und ermordet. Deutlich über 100.000 Menschen wurden durch systematische Plünderungen vor allem im Winter 1941/42 dem Hungertod ausgesetzt. Tausende wurden in Konzentrationslagern ermordet. Die Deutschen verließen Griechenland mit einer „Politik der verbrannten Erde“ und zerstörten noch beim Abzug Straßen, Bahnlinien, Brücken und Städte.
Distomo 1995 – ein Überlebender klagt
Argyris Sfountouris gehört zu den Überlebenden von Distomo. Der damals Dreijährige konnte sich mit seinen drei älteren Schwestern verstecken, während ihre Eltern ermordet wurden. Er wuchs als Waise in Kinderheimen in Athen und in der Schweiz auf, wurde Lehrer, Entwicklungshelfer, ein renommierter Physiker und Schriftsteller.
Viele Jahre später richtete Sfountouris im Namen aller Überlebenden von Distomo eine Anfrage an die deutsche Botschaft in Athen: ob für die Opfer des Massakers eine Entschädigung vorgesehen sei. Im Januar 1995 erhielt er die ablehnende Antwort, dass der Mord seiner Eltern und der anderen Dorfbewohner:innen „Maßnahmen im Rahmen der Kriegsführung“ gewesen seien. Deshalb sei keine Entschädigung vorgesehen. Sfountouris empfand diese Ablehnung als Schlag ins Gesicht. Er sah es als Fortsetzung des grausamen Denkens der deutschen Besatzer, dass Deutsche 50 Jahre nach dem Massaker keine Verantwortung für die Taten übernahmen und das brutale Morden als „Maßnahmen“ verharmlosten.
1995 verklagten Sfountouris und 296 Hinterbliebene die Bundesrepublik vor einem deutschen und einem griechischen Gericht. In Deutschland blieb die Klage durch alle Instanzen erfolglos. Vor griechischen Gerichten wurde eine Entschädigung von umgerechnet 28 Mio. Euro festgesetzt. Doch auf Druck der deutschen Regierung hin verhinderte die griechische Regierung selbst, dass deutscher Besitz in Athen gepfändet und damit Geld an die Opfer ausgezahlt wird. Bewusst vermieden deutsche Politiker:innen immer wieder im Zusammenhang mit dem Massaker von „Verbrechen“ zu sprechen. Sie wollten keine Argumente liefern, dass eine Verurteilung Deutschlands rechtmäßig sei.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte empfahl den Opfern 2001, das griechische Urteil in Italien vollstrecken zu lassen. Dort war die Vollstreckung vor Gericht 2008 erfolgreich. Seither übt Deutschland Druck auf Italien aus und verhindert bis heute die Auszahlung bereits rechtskräftig gepfändeter Gelder an die Opfer. Dies geschah einerseits durch starke diplomatische Beeinflussung und andererseits durch eine juristische Hinhaltetaktik vor vielen internationalen Gerichten.
Verantwortung für Geschichte heute
Bis 1990 hat die Bundesrepublik Anfragen zu Entschädigungen und Kriegsreparationen abgelehnt. Sie seien mit Verweis auf einen zukünftigen Friedensvertrag zu früh. Nach der Vereinigung von BRD und DDR 1990 wurden die Anfragen dann zunächst mit dem Argument abgelehnt, dass der Einigungsvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier alliierten Mächten noch kein Friedensvertrag sei. Später behauptete die Bundesregierung, mit dem Einigungsvertrag seien alle Ansprüche erledigt. So wurde in Deutschland verhindert, dass andere Staaten, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, Reparations- und Entschädigungsansprüche berücksichtigen konnten.
Wegen dieses deutschen Regierungshandelns gab es auch für die Opfer von Distomo nie eine Chance, Anerkennung und Entschädigung aus Deutschland zu erhalten. Es scheint, als würde in Deutschland der Kampf der Überlebenden um Anerkennung und Entschädigung durch deren Versterben ausgesessen: ein Spiel auf Zeit. Dazu sagte Argyris Sfountouris 2001: „Erinnerung kann aber nur beginnen, nachdem man die Ereignisse wahrgenommen hat, die ganze Wahrheit des Geschehenen angenommen hat. […] Distomo ist zum Symbol geworden. Zum Symbol dafür, dass Deutschland noch immer in der Schuld der Opfer steht. […] Aber die deutschen Regierungen sind gegenüber den Opfern noch immer Rechtsbrecher. Die Rücksichtslosigkeit der deutschen Politik ist eine logische Fortsetzung der Plünderungen durch die Nazis. […] Macht- und Bereicherungsgier können nie ersatzlos gestrichen werden. […] Deutschland weigert sich, zu verhandeln, es will die Null-Lösung diktieren.“
Doaa Al Zamel und Filimon Mebrhatom – zwei Schicksale
2014 wagte der 14-Jährige Filimon Mebrhatom die Flucht nach Europa aus seiner Heimat Eritrea. Das afrikanische Land wird seit 1993 von dem Diktator Isayas Afewerki autoritär regiert. Durch die Flucht entkam der 14-Jährige der Einberufung zum Militär. Der Wehrdienst in Eritrea ist unbefristet.
2012 verließ die Teenagerin Doaa Al Zamel mit ihrer Familie Syrien. Ihre Heimatstadt wurde von Soldaten des Assad-Regimes terrorisiert. Während des „Arabischen Frühlings“ hatte sie an Demonstrationen gegen die Diktatur Baschar al-Assads teilgenommen. Ihre Familie war daraufhin ins Visier des Regimes geraten.
Sowohl Al Zamel als auch Mebrhatom legten eine gefährliche Flucht zurück. Auf dem langen Weg über das Mittelmeer war ihr Leben mehrmals bedroht. Das Boot Al Zamels wurde vorsätzlich von Schleppern auf dem Mittelmeer gerammt, woraufhin es kenterte. Ihr Verlobter, den sie auf der Flucht kennengelernt hatte, ertrank in den Wellen. Sie selbst konnte sich mithilfe eines Schwimmrings für Kinder vier Tage lang über Wasser halten, bis sie von einem Handelsschiff gerettet wurde. Andere geflüchtete Menschen hatten ihr im Boot ein Baby anvertraut. Sie konnte es die gesamte Zeit über Wasser halten. Es starb jedoch an Bord des Schiffes.
Auf seinem Weg hatte Mebrhatom in einem libyschen Geflüchtetenlager ein Massaker und die Versklavung durch Dschihadisten überlebt. Bei seiner Flucht über das Mittelmeer geriet das marode Boot in Seenot. Die italienische Küstenwache rette die Menschen und brachte sie nach Italien. Heute lebt Al Zamel in Schweden und Mebrhatom in der Nähe von München.
Für wen gelten Menschenrechte?
Seenotrettungsaktionen wie die, bei der Mebrhatom gerettet wurde, finden seit dem Frühjahr 2019 kaum noch statt. Die EU-Mittelmeeranrainerstaaten delegieren die Verantwortung meist an die libysche Küstenwache. Diese verbringt die Geflüchteten jedoch gemäß dem Wunsch der EU-Staaten systematisch wieder in die libyschen Geflüchtetenlager. Berichte aus diesen Lagern zeugen von Folter, Vergewaltigung, Versklavung und Mord. Hygienische Mindeststandards, medizinische Versorgung oder ausreichende Verpflegung mit Lebensmitteln sind dort nicht gewährleistet. Die EU verlässt sich auf Libyen und unterstützt somit ebenjenen „failed state“, obwohl die menschenrechtlichen Missstände dort in Europa seit langem bekannt sind und diskutiert werden.
Die Genfer Flüchtlingskonvention billigt jedem Menschen das Recht zu, über Landesgrenzen zu flüchten und Asyl zu beantragen. Zudem verpflichtet die Menschenrechtskonvention alle Staaten, Menschen Schutz zu bieten, die in ihrem Heimatland verfolgt werden.
Dennoch unterstützt die EU mittels der europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex unter anderem im Grenzgebiet Griechenlands sogenannte Pushbacks: Geflüchtete, häufig in nicht seetüchtigen Booten, werden an den Grenzen zurückgedrängt und auf dem offenen Meer ihrem Schicksal überlassen. Nicht selten enden Pushbacks damit, dass geflüchtete Menschen ertrinken. Laut der Genfer Flüchtlingskonvention ist dieses Vorgehen illegal. Aus diesem Grund werden die Pushbacks durch Frontex oder die beteiligten EU-Staaten geleugnet und verschleiert, wie 2022 der Bericht der OLAF, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, welches seit Ende 2020 Vorwürfe gegen die Agentur untersuchte, im Detail belegt.
Zivile Seenotrettung zwischen Menschenrechten und Strafverfolgung
Vor dem Hintergrund der nicht ausreichenden und seit 2019 kaum noch vorhandenen Seenotrettung durch die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben sich verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen gegründet. Diese in der Regel durch Spenden finanzierten Organisationen chartern in eigener Regie Schiffe, die versuchen, im Mittelmeer in Seenot geratene geflüchtete Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
Im Juli 2019 rettete das Schiff Sea-Watch 3 der Organisation Sea-Watch im Mittelmeer nördlich der libyschen Küste 53 Menschen. Die italienischen Behörden verweigerten dem Schiff unter der deutschen Kapitänin Carola Rackete die Einfahrt in einen sicheren Hafen. Nach einigen Tagen wurden die medizinischen Notfälle nach Italien gebracht. Die Crew verblieb mit den übrigen geretteten Menschen auf hoher See.
Die Versorgungslage an Bord und die psychische Situation der Menschen hatte sich aufgrund des langen Ausharrens auf dem Schiff stark verschlechtert. Deshalb entschied Kapitänin Rackete entgegen den Anweisungen der italienischen Behörden, in den Hafen von Lampedusa einzulaufen. Noch beim Anlegemanöver versuchte ein Boot der italienischen Küstenwache die Sea-Watch 3 zu blockieren. Nach der Landung konnten die geflüchteten Menschen endlich an Land gehen. Die Kapitänin wurde von den italienischen Behörden festgenommen. Die Geschichte der Sea-Watch 3 steht stellvertretend für die heute gängige Praxis einiger EU-Staaten, Seenotrettung nicht bloß zu unterlassen, sondern den Einsatz ziviler Seenotretter:innen aktiv zu verhindern und sogar zu kriminalisieren.
Amadeu António galt unter seinen Freund:innen in Eberswalde als geselliger Mensch, der Musik liebte. Wenige Tage, nachdem ihn eine Gruppe bewaffneter Neonazis zusammengeschlagen hatte, starb der 28-Jährige an seinen Verletzungen.
1987 zog der junge Angolaner Amadeu António als Vertragsarbeiter in die DDR. Er hatte den Traum, dort Flugzeugtechnik zu studieren. Stattdessen wurde er im Eberswalder Schlacht- und Verarbeitungskombinat zum Fleischer ausgebildet. Für Angolaner:innen war es nicht leicht, mit der heimischen Bevölkerung Kontakt aufzunehmen.
Trotzdem wollte António sich mit seiner schwangeren Freundin eine Existenz in Brandenburg aufbauen. Am 24. November 1990 traf sich António mit Freund:innen im Hüttengasthaus. An den meisten anderen Orten waren sie nicht willkommen. Am selben Abend zogen 50 angetrunkene Neonazis zu der Gaststätte, um ihren Hass auf Migrant:innen auszuleben. Die Polizei wusste davon und informierte den Wirt, der seine Gäste daraufhin hinausbat. Gemeinsam mit zwei mosambikanischen Freunden und zwei deutschen Freundinnen lief Amadeu António direkt in die Arme seiner mit Zaunlatten und Schlagstöcken bewaffneten Mörder. Antónios Begleiter:innen konnten entkommen. Er wurde von zehn Angreifern verfolgt, die ihn brutal zusammenschlugen und lebensbedrohlich verletzten.
Drei anwesende Zivilpolizisten beobachteten das Geschehen und riefen Unterstützung. Die 20 um die Ecke stationierten Polizisten griffen nicht ein. Am 6. Dezember 1990 erlag der 28-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Amadeu António ist eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt im vereinigten Deutschland. Verschiedene Initiativen kämpfen für die Erinnerung an Amadeu António. Eine Straßenumbenennung konnte jedoch bis heute nicht realisiert werden.
Die Bundesregierung zählt zwischen 1990 und 2021 113 rechtsextreme Morde. Die nach António benannte Amadeu Antonio Stiftung hingegen rechnet mit 219 Todesopfern rechter Gewalt. Sie geht außerdem von weiteren 16 Verdachtsfällen und einer erheblich größeren Dunkelziffer aus.
Der Bahnhofsvorplatz in Berlin-Lichtenberg soll nach Eugeniu Botnari umbenannt werden. Das forderten dort am 17. September 2020 Menschen aus dem Stadtbezirk, die schon mal provisorische Straßenschilder mitgebracht hatten.
Genau vier Jahre zuvor hatte der Filialleiter eines Supermarktes im Bahnhof den obdachlosen Eugeniu Botnari in das Getränkelager des Ladens geführt. Weil er ihn des Diebstahls verdächtigte, schlug er ihm mit Quarzsandhandschuhen mehrfach ins Gesicht. „Wie ein Hund“ sei er geschlagen worden, erzählte der aus Moldawien stammende 34-Jährige am selben Abend seiner Cousine. Da er nicht versichert war, entschied er sich zunächst gegen einen Ärzt:innenbesuch. Erst als sich sein Zustand sichtbar verschlechterte, suchte er zwei Tage später eine Praxis auf, die ihn in die Notaufnahme überwies. Am folgenden Tag, dem 20. September 2016, starb er an einer Hirnblutung. Der Täter behauptete, er habe dem „Ladendieb“ eine Lektion erteilen wollen. Die Erzählung vom „Ladendieb“ übernahmen auch viele Medien, obwohl es für einen Diebstahl keine Belege gab.
Gut dokumentiert dagegen ist die Gewalttat selbst – auf einem Überwachungsvideo aus dem Supermarkt. Der Schläger filmte das Video ab und sendete es mit menschenverachtenden Kommentaren an Mitarbeiter:innen. Ein halbes Jahr später wurde der Täter von einem Gericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Botnaris Frau trat als Nebenklägerin auf.
Obdachlose sind oft Gewalt ausgesetzt, auch weil ihnen häufig eine Mitschuld an ihrem Schicksal unterstellt wird. Solche sozialdarwinistischen Anschauungen haben eine lange Tradition, die in der Verfolgung und Ermordung von „Asozialen“ oder „Berufsverbrechern“ im Nationalsozialismus gipfelte. Im Januar 2023 beschloss der Bezirk, den Bahnhofsvorplatz in „Eugeniu-Botnari-Platz“ umzubenennen, um auf die oft ignorierte Gewalt gegen obdachlose Menschen hinzuweisen.
„Reisegenuss“ lautete der Schriftzug auf der Vorderseite des Busses, der am 18. Februar 2016 Menschen aus dem Irak, Afghanistan und Syrien in ihre Unterkunft in Clausnitz bringen sollte. Als die geflüchteten Menschen in dem sächsischen 800-Seelen-Dorf ankamen, sahen sie sich von einem fremdenfeindlichen Mob umringt.
Einer der Täter nahm die Szene mit seinem Handy auf. Das ins Internet hochgeladene Video wurde vielfach in sozialen Netzwerken geteilt und von den Medien aufgegriffen. Diese Bilder von schutzsuchenden und verängstigten Menschen, die beim Verlassen des Busses bedrängt und bedroht wurden, gingen so um die Welt.
In den Jahren 2015 und 2016 suchten ca. zwei Millionen Menschen Zuflucht in Europa. Sie kamen über das Mittelmeer oder entlang der sogenannten Balkanroute. Im Jahr 2015 hat Deutschland etwa 890.000 geflüchtete Menschen aufgenommen. Getragen von einer Welle der Sympathie, engagierten sich mehr als zehn Prozent der Bevölkerung für die Asylsuchenden. Dieser Einsatz und diese Mitmenschlichkeit wurden unter dem Begriff „Willkommenskultur“ bekannt. Während die einen mit Empathie halfen, reagierten die anderen mit Ablehnung. So stellten selbsternannte „besorgte Bürger:innen“ das Recht auf Asyl in Frage und Teile der gesellschaftlichen Mitte radikalisierten sich. In Clausnitz skandierte die Menge „Wir sind das Volk!“ – und benutzte damit einen Slogan der Friedlichen Revolution von 1989. Doch ihr Protest war alles andere als friedlich: Die Menschen, die vor den Kriegen im Irak, in Afghanistan und in Syrien geflüchtet waren, sahen sich nun auch hier bedroht.
Laut Statistik kommt es bis heute bundesweit zu zwei Übergriffen auf geflüchtete Menschen pro Tag.
Im Jahr 1983 blickte eine Frau in Darmstadt auf ihr zerstörtes Haus und die Abrissbagger. Die Familie war nachts von einer Reise zurückgekehrt. Ihr Hab und Gut lag unter den Trümmern begraben: ein vorläufiger Höhepunkt von vier Jahren antiziganistischer Stimmungsmache und behördlichem Rassismus.
1979 waren mehrere aus Jugoslawien stammende Familien auf drei kommunale Wohnhäuser in Darmstadt verteilt worden. Sofort gab es in Nachbarschaft und Presse antiziganistische Gerüchte über „Wäschediebe“ und „okkulte Rituale“, die nie bestätigt wurden. Nachbar:innen beschwerten sich über den Wertverlust ihrer Immobilien. Mehrfach durchsuchten Polizist:innen mit gezogenen Waffen die Wohnräume der Familien. In der Nacht auf den 3. Januar 1982 verübten Unbekannte einen Sprengstoffanschlag auf ein Wohnhaus.
Als die Anwesenden aus dem Haus rannten, wurden sie mit Steinen beworfen. Der damals vierjährige Gianni Jovanovic wurde am Kopf verletzt. Die Täter:innen wurden nie gefasst. Die vier Erwachsenen und zwölf Kinder mussten das Haus verlassen und wurden in eine Baracke auf einem Müllabladeplatz am Stadtrand umquartiert.
Befreite jüdische Geiseln einer Flugzeugentführung kommen am 4. Juli 1976 erschöpft und erleichtert in Israel an.
Ein vierköpfiges Kommando der „Volksfront zur Befreiung Palästinas Auswärtige Operationen“ hatte am 27. Juni 1976 eine Air-France-Maschine mit 258 Passagier:innen und 12 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris entführt und im ugandischen Entebbe zur Landung gezwungen. Unter den Entführer:innen waren auch zwei Deutsche: Brigitte K. und Winfried B., Mitglieder der linksterroristischen „Revolutionären Zellen“. Mit der Entführung wollten sie die Freilassung von 53 gefangenen Terrorist:innen aus israelischen, schweizerischen und deutschen Gefängnissen sowie fünf Millionen US-Dollar erpressen. In einer Erklärung bezeichneten sie Israel als „Feind der Menschheit“ und forderten dazu auf, gegen diesen Feind „die Waffen zu erheben“.
Am dritten Tag der Entführung ließen die Entführer:innen, die nichtjüdischen Geiseln frei. Sämtliche Juden:Jüdinnen (nicht nur israelische Staatsbürger:innen) jedoch wurden von den Terrorist:innen weiter gefangen gehalten.
An der Aufteilung der Geiseln in Juden:Jüdinnen und Nicht-Juden:Jüdinnen waren die beiden deutschen Entführer:innen aktiv beteiligt. Viele Geiseln erinnerten diesen Moment später als besonders dramatisch, auch weil erstmals seit der Schoah Deutsche über das Schicksal von Juden:Jüdinnen entschieden.
Am Morgen des 4. Juli 1976 flog ein Kommando der israelischen Armee mit mehreren Flugzeugen nach Entebbe und befreite die Geiseln. Bei der Aktion starben zwei Geiseln, ein israelischer Soldat, alle Entführer:innen und mindestens 20 ugandische Soldaten, die den Flughafen bewachten. Weil Kenia die Israelis mit den befreiten Geiseln auf dem Rückweg nach Israel zwischenlanden ließ, ermordete der ugandische Diktator Idi Amin als Vergeltung 200 in Uganda lebende Kenianer:innen. Zu einer Diskussion über die antisemitischen Motive der weitverbreiteten israelfeindlichen Haltung in der radikalen deutschen Linken kam es erst viele Jahre später.
In den Unterlagen der Staatssicherheit der DDR wurde das erste deutsche Pogrom der Nachkriegszeit als „Operativvorgang ‚Unruhe‘“ beschrieben.
Der Auslöser war ein rassistisches Gerücht: Im Jahr 1975 behauptete ein Erfurter Kraftfahrer, mehrere algerische Vertragsarbeiter hätten Deutsche attackiert und eine Frau vergewaltigt. Bald verbreiteten sich weitere Gerüchte über angeblich durch die Algerier begangene Morde wie ein Lauffeuer in Erfurt. Später gab der Kraftfahrer zu, sich die Taten nur ausgedacht zu haben. Die Lügen über die algerischen Vertragsarbeiter setzten ab dem 10. August 1975 ein mehrtägiges Pogrom in Gang. Die Staatssicherheit notierte, dass es am 10. August zu „Vorkommnissen und Ausschreitungen“ zwischen Deutschen, Ungarn und Algeriern gekommen sei.
Konkret wurden algerische Vertragsarbeiter von aufgebrachten DDR-Bürger:innen verprügelt. Aus einer johlenden Zuschauer:innenmenge wurde „Tod den Algeriern“ skandiert. Anschließend wurden die Vertragsarbeiter mit Latten und Stangen in Richtung des Erfurter Hauptbahnhofes getrieben.
Am 12. August kam es zu einer weiteren rassistischen Hetzjagd, bei der 50 bis 60 DDR-Bürger:innen etwa 12 Algerier durch die Stadt jagten, bis sich diese schließlich in ein Postgebäude flüchteten. Vor dem Gebäude versammelten sich Menschen, die erneut zum Mord an den Vertragsarbeitern aufriefen. Die Polizei eskortierte die Algerier durch einen Hinterausgang zu ihrem Wohnheim. Am nächsten Tag wurde das Wohnheim von einem rassistischen Mob belagert. Die Polizei konnte diesen schließlich vertreiben.
Das Pogrom von Erfurt war Ausdruck eines in der Bevölkerung der DDR tief verankerten Rassismus, trotz des staatlich verordneten Antifaschismus. Viele meinten, der Staat würde die Vertragsarbeiter:innen besser behandeln als sie selbst. In Wirklichkeit wurde den aus anderen sozialistischen Ländern angeworbenen Arbeiter:innen pro Person weniger Wohnraum zugestanden als der einheimischen Bevölkerung. Bei der Ankunft in der DDR wurden ihnen die Pässe abgenommen, auf Ämtern und von Ärzt:innen wurden sie diskriminiert. Dieser institutionelle Rassismus fand seine Entsprechung im Rassismus der Bevölkerung.
Im Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Fasanenstraße fand am Abend des 9. November 1969 das Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 mit gut 250 Gästen statt. Unter die Gäste hatte sich auch der Terrorist Albert F. gemischt, der eine Bombe unter einem Getränkeautomaten versteckte. Da der Zünddraht korrodiert war, explodierte die Bombe nicht.
Das antisemitische Attentat war von der linksterroristischen Gruppierung „Tupamaros West-Berlin“ geplant worden. Mitglieder der Gruppe hatten sich zuvor in einem Trainingscamp der palästinensischen Fatah an der Waffe und im Bombenbau ausbilden lassen. Die „Tupamaros West-Berlin“ waren Vorläufer der linksterroristischen „Rote-Armee-Fraktion“, der zwischen 1971 und 1993 34 Menschen zum Opfer fielen. Die Linksradikalen hatten sich für eine ihrer ersten terroristischen Aktionen in der Bundesrepublik Deutschland ausgerechnet die jüdische Gemeinde ausgesucht, zumal an einem Tag des Gedenkens an die Schoah.
Das kann kein Zufall gewesen sein. Noch 2008 sagte der Bombenleger, der Anschlag sei zwar „antizionistisch“, aber nicht antisemitisch gewesen. Dabei hatten die Täter:innen in einem Bekennerbrief formuliert: „Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden …“.
Über den Umweg einer Verteufelung Israels konnte wieder Antisemitismus propagiert werden. Diese Relativierung des deutschen Massenmordes an sechs Millionen Juden:Jüdinnen ist – wie auch der Hass auf Israel – ein typischer Ausdruck des Antisemitismus nach der Schoah. Die bei dem Gedenken 1969 anwesende Schoah-Überlebende Ruth Galinski kommentierte: „Man kann gar nicht glauben, dass Kinder der Täter so etwas tun. Das Gift scheint immer noch drin zu sein“. Die Bombe hatte die Gruppe von Peter U. erhalten, einem Mitarbeiter des Berliner Verfassungsschutzes. Der V-Mann versorgte die „Tupamaros“ wiederholt mit Bombenmaterial und Waffen. Seine Rolle konnte nie ganz aufgeklärt werden. Ebenso wenig die seiner Vorgesetzten und des damals zuständigen Innensenators Kurt Neubauer.
Seit dem Anschlag sind permanente Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen Normalität. Antisemitische Angriffe aus verschiedenen politischen Richtungen bleiben eine ständige Bedrohung für Juden:Jüdinnen.
Armin Kurtović erläutert Aufnahmen einer Überwachungskamera aus der Arena Bar in Hanau. Am 19. Februar 2020 wurde sein 22-jähriger Sohn Hamza Kurtović dort von einem Rechtsterroristen erschossen.
Armin Kurtovićs Tochter hatte ihm von einer Schießerei in Hanau berichtet. Daraufhin rief er seine beiden Söhne an, um sich zu vergewissern, dass es ihnen gut gehe. Da sein Sohn Hamza Kurtović nicht antwortete, machte sich Armin Kurtović auf den Weg zur Arena Bar. An der Polizeiabsperrung beschrieb er einem Polizisten seinen Sohn und dessen markante Kleidung. Der Polizist antwortete ihm, dass eine Person, die auf diese Beschreibung passe, nicht unter den Opfern des Attentats sei.
Hamza Kurtovićs Familie wurde lange Zeit über sein Schicksal im Unklaren gelassen. Armin Kurtović kritisiert den Polizeieinsatz und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Da es nach wie vor viele offene Fragen gibt, versucht er gemeinsam mit anderen Angehörigen, die Ereignisse zu rekonstruieren. Im Zuge der Aufklärung des Anschlags stellte sich etwa heraus, dass die Fluchttür der Bar grundsätzlich verschlossen war.
Die Analysen der Forschungsagentur „Forensic Architecture“ ergaben, dass sich vier, wahrscheinlich sogar fünf der Opfer hätten retten können, wäre die Tür nicht verschlossen gewesen. Der 43-jährige Täter ermordete in Hanau neun Menschen. Anschließend erschoss er seine Mutter und sich selbst. Seine Motive waren Rassismus und Verschwörungsdenken, die er im Internet offen vertrat.
Hamza Kurtović hatte im Sommer seine Berufsausbildung zum Fachlageristen abgeschlossen. Neben ihm wurden am 19. Februar noch Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov ermordet. Die Angehörigen der Opfer des Anschlags gründeten eine Initiative, prägten den Slogan #saytheirnames, fordern lückenlose Aufklärung und ein Denkmal. Damit wollen sie auf die gesellschaftlichen Ursachen von rassistischer Gewalt aufmerksam machen und den Opfern eine Stimme geben.
Vertreter:innen der Herero und Nama aus Namibia demonstrieren am 16. Oktober 2016 in der Nähe des Berliner Humboldt Forums. Als Nachkommen fordern sie eine Entschädigung für den Völkermord deutscher Kolonialtruppen an ihren Vorfahr:innen zwischen 1904 und 1908 in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika.
Dem Völkermord vorausgegangen war eine Siedlungspolitik, mit der den ansässigen Bäuer:innen und Viehzüchter:innen ihr Land geraubt wurde. Ohne Weideflächen verloren die nomadischen Herero ihre Existenzgrundlage. Deshalb griffen sie am 12. Januar 1904 die deutschen Kolonialtruppen an. Der Deutsche Kaiser Wilhelm II. entsandte Lothar von Trotha als Oberbefehlshaber in die Kolonie, um den Aufstand niederzuschlagen. Im Oktober gab von Trotha den berüchtigten Vernichtungsbefehl, der vorsah, die Herero auszurotten. Viele Herero starben auf der Flucht in der Halbwüste Omaheke. Auch das Volk der Nama sah sich 1904 gezwungen, in den Krieg einzutreten. Wieder reagierten die deutschen Truppen mit äußerster Brutalität.
In der Folge wurden Gefangenenlager eingerichtet und die Bevölkerung zur Zwangsarbeit verpflichtet. Ein Drittel bis die Hälfte der Internierten starb. Schätzungen gehen von insgesamt bis zu 100.000 Ermordeten aus.
Über 100 Jahre lang hat Deutschland den Völkermord an ca. 80 % der damals lebenden Herero nicht anerkannt. 2015 hat eine deutsche Regierung erstmals Verhandlungen mit der namibischen Regierung aufgenommen und im Mai 2021 eine „Wiederaufbauhilfe“ angekündigt. Deutschland vermeidet es jedoch, von Reparationen zu sprechen, um die Berechtigung des Anspruchs auf Entschädigung für den Völkermord nicht offiziell anzuerkennen. Hinterbliebene der Herero und Nama waren an den Verhandlungen nicht beteiligt und erkennen die „Wiederaufbauhilfe“ nicht an. Bis heute gehört den Nachkommen der Siedler:innen 70 % des Landes. Der in Deutschland lebende Herero-Aktivist Israel Kaunatjike erklärte 2022: „Wir sind noch immer in einem Kampf, in einem Kampf um Anerkennung.“
Joseph Wulf zündet sich vor der Villa Am Großen Wannsee 56–58 eine Pfeife an. Ab Mitte der 1960er Jahre setzte er sich dafür ein, dass in der Villa ein internationales Dokumentationszentrum zur Erinnerung an die sechs Millionen von Deutschen ermordeten Juden:Jüdinnen eingerichtet wird. Die Eröffnung der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz 1992 sollte er nicht mehr erleben.
Der 1912 in Chemnitz geborene und in Krakau aufgewachsene Mann war der erste, der die deutsche Nachkriegsgesellschaft mit dem nationalsozialistischen Völkermord konfrontierte. Wulf war selbst jüdischer Widerstandskämpfer und Überlebender des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Auf einem der sogenannten Todesmärsche gelang ihm 1945 die Flucht. Seine Frau und seinen Sohn fand er nach dem Krieg wieder. Die übrigen Familienmitglieder sind von den Nazis ermordet worden. Nach dem Krieg lebte er in Polen und Frankreich. 1952 zog er nach Berlin. Dort fühlte sich der deutsch-jüdische Historiker Zeit seines Lebens als Fremder.
Die Wirtschaftswunder-Gesellschaft der Bundesrepublik wollte die jüngste Vergangenheit vergessen. Mit seinen Forschungen zum Nationalsozialismus stieß Joseph Wulf auf taube Ohren. Diese störten insbesondere dort, wo Wulf die Geschichte von NS-Täter:innen zum Vorschein brachte, die in der jungen Bundesrepublik wieder zu Macht und Ansehen gelangt waren.
1974, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau, nahm er sich das Leben. 18 Jahre nach Wulfs Tod wurde die Gedenk- und Bildungsstätte eröffnet und deren Bibliothek nach ihm benannt. Mit Blick auf den bis heute oft geforderten „Schlussstrich“ unter die Beschäftigung mit der Schoah erklärte er: Die einzigen, die hier das Recht hätten, zu schweigen, seien die Überlebenden der Konzentrationslager. An die Täter:innen und deren Nachfahren gerichtet fragte er: „Mit welchem Recht jedoch kann ein Volk, das Menschen wie Tiere tätowiert hat, [eine] solche Tat vergessen?“
Malte C. nahm am 27. August 2022 in Münster zusammen mit vielen anderen Menschen am Christopher Street Day (CSD) teil. Traditionell treffen sich zu diesem Anlass lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter*geschlechtliche sowie queere Menschen, um für Selbstbestimmung, soziale Anerkennung und gleiche Rechte einzutreten und dabei auch gemeinsam sich selbst zu feiern.
Der 25-jährige Trans*mann Malte C. lief an diesem Tag erstmals oberkörperfrei auf der Demo mit, nachdem er vor kurzem eine geschlechtsangleichend Operation hinter sich gebracht hatte. Freunde berichten, dass er sehr glücklich gewesen sei. Er präsentierte stolz die Flagge des Vereins Trans*-Inter*-Münster. Als ein 20-jähriger Mann zwei Frauen kurz nach der Veranstaltung sexistisch wie auch lesben- und trans*feindlich beleidigte und bedrohte, kam Malte dazu und bat den Angreifer, das zu unterlassen.
Dieser schlug Malte zweimal ins Gesicht, sodass er mit dem Kopf auf den Asphalt schlug, aufgrund von Hirnblutungen notoperiert und ins künstliche Koma versetzt werden musste. Sechs Tage später verstarb er im Krankenhaus.
In den darauffolgenden Tagen zeigten bundesweit viele Menschen ihre Empörung und forderten ein entschiedenes Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden. Der Täter schwieg zu seinen Motiven. Ermittelt wird wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Straftatbestand wegen queer-, trans*- oder inter*feindlicher Hasskriminalität liege laut einer Gutachterin nicht vor. Die Polizei erfasst Straftaten wegen Geschlechtszugehörigkeitoder geschlechtlicher Identität explizit erst seit 2020. Laut einer EU-Umfrage hat jede 5. Trans*Person bereits Erfahrungen mit Gewalt und körperlichen Übergriffen gemacht.
In der Bevölkerung sind queerfeindliche Haltungen und heteronormative Intoleranz weit verbreitet. Malte C. bewies Zivilcourage.
Im Gedenken an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret wurde unter der Saalebrücke in Merseburg ein Wandgemälde angefertigt. Die beiden kubanischen Vertragsarbeiter starben infolge einer rassistischen Hetzjagd am 12. August 1979.
Bereits am 11. August war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Kubanern auf der einen sowie Ungarn und Deutschen auf der anderen Seite gekommen, in deren Verlauf auch unbeteiligte kubanische Vertragsarbeiter niedergeschlagen wurden. Am nächsten Abend stellte eine Gruppe Vertragsarbeiter ihre Peiniger in einer Merseburger Diskothek. Schließlich mussten die Kubaner jedoch fliehen. Eine größere Gruppe DDR-Bürger:innen hetzte die Männer auf eine Brücke. Ob die Kubaner ihre Flucht durch einen Sprung ins Wasser fortsetzen wollten oder ob ihre Verfolger:innen sie von der Brücke warfen, ist nicht bekannt. Im Wasser wurden sie mit Flaschen und Steinen beworfen. Die Leichen von Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret wurden erst Tage nach der Tat geborgen.
Die Volkspolizei nahm noch am gleichen Abend Ermittlungen auf. Das Ministerium für Staatssicherheit ließ die Ermittlungen jedoch einstellen, um die Beziehungen zwischen der DDR und der Sozialistischen Republik Kuba nicht zu gefährden.
Die Hetzjagd von Merseburg war Ausdruck des institutionellen und gesellschaftlichen Rassismus in der DDR. Diese stellte sich jedoch als antifaschistischer Staat dar. Der Rassismus, den Vertragsarbeiter:innen aus Angola, Kuba, Mosambik, Vietnam und anderen Staaten erlebten, wurde deshalb totgeschwiegen. Keine:r der Täter:innen wurde für die Lynchmorde in Merseburg bestraft. Kuba beendete in der Folge die Entsendung von Vertragsarbeiter:innen in die DDR. Obwohl Mord nicht verjährt, lehnte die Staatsanwaltschaft Halle die Wiederaufnahme der Ermittlungen 2016 unter Berufung auf die damaligen Ermittlungen ab. Damit übernahm die bundesdeutsche Justiz die politisch motivierten Einschätzungen der DDR.
Die Täter:innen blieben weiterhin straffrei. Das Wandgemälde zum Gedenken an die zwei Kubaner wurde entfernt. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Künstler:innen wurde 2021 eingestellt.
Ignatz Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, besuchte am ersten Jahrestag des rassistischen Brandanschlags in Mölln den Ort des Verbrechens. Mit dieser Geste gedachte er den Opfern und warnte vor den Gefahren des Rechtsextremismus. In der Nacht des 23. November 1992 hatten Neonazis Brandsätze auf zwei Häuser geworfen. Dabei kamen drei Menschen zu Tode: die zehnjährige Yeliz Arslan, die 14-jährige Ayşe Yılmaz und die 51-jährige Bahide Arslan. Neun Menschen wurden schwer verletzt. Mölln wurde zum Symbol für den erstarkenden Rechtsradikalismus im vereinten Deutschland.
Der Brandanschlag löste Entsetzen aus und fand viel Beachtung. Die Familien der Opfer wurden allerdings nach einigen Jahren bei der Gestaltung des offiziellen Gedenkens der Stadt Mölln nicht mehr beteiligt. Sie durften nicht mehr selbst auswählen, welche Sprecher:innen eingeladen wurden. Die Veranstaltung wurde so zum leeren Ritual. Auch deshalb entwickelte die Familie Arslan eine eigene Form des Gedenkens: die „Möllner Rede im Exil“.
Seit 2013 erinnern die beiden betroffenen Familien gemeinsam mit Unterstützer:innen jährlich an die Anschläge in Mölln und ähnliche Ereignisse. Die Redner:innen werden durch die Familien ausgesucht. Die Solidarität mit anderen Opfern rechter Gewalt ist Faruk Arslan, dem Vater der bei dem Anschlag ums Leben gekommene Yeliz Arslan, ebenso wichtig, wie sie es Ignatz Bubis 1993 war. Bei der Möllner Rede im Exil 2021 sagte Faruk Arslan mit Bezug auf die jüngsten Anschläge: „Ich bin nicht nur Vater von Mölln, ich bin auch ein Teil von Hanau, ich bin ein Teil von Halle, ich bin ein Teil von Berlin, ich bin ein Teil von allen Opfern…“.
Über 3000 Briefe mit Beileids- und Solidaritätsbekundunge sowie Hilfsangeboten an die Familien Arslan und Yılmaz verblieben über Jahre hinweg bei der Stadt Mölln, die diese zurückhielt. Die Familien erfuhren von den Briefen erst zufällig im Jahr 2019. Die Täter von Mölln kamen bereits nach wenigen Jahren wieder auf freien Fuß.
Nach dem Anschlag auf das Oktoberfest am 26. September 1980 ist die Theresienwiese in München ein Ort der Verwüstung. Ein 21-jähriger Rechtsextremist hatte mit einer handgefertigten Bombe zwölf Menschen und sich selbst getötet. 221 Personen wurden verletzt.
Die Ermittlungen führten zunächst zu dem Schluss, dass der Täter aus persönlichen Motiven gehandelt und einen erweiterten Suizid begangen habe. Seine Mitgliedschaft in den beiden rechtsextremen Organisationen „Wiking-Jugend“ und „Wehrsportgruppe Hoffmann“ aber legten schon damals die Vermutung nahe, dass der Täter in ein Terrornetzwerk eingebunden war. Allein 1981 wurden in Deutschland 33 Depots mit Sprengstoff und Waffen gefunden. Das Netzwerk Hoffmann war auch an den antisemitischen Morden an Rabbiner Shlomo Lewin und seiner Lebensgefährtin Frida Poeschke in Erlangen am 19. Dezember 1980 beteiligt. Ziel der Rechtsterroristen war es, Schrecken zu verbreiten und auf einen Umsturz hinzuwirken.
Die Opfer leiden bis heute daran, dass der Anschlag nie richtig aufgeklärt wurde. Robert Höckmayr war 1980 zwölf Jahre alt. Seine beiden jüngeren Geschwister fielen dem Attentat zum Opfer. Höckmayr überlebte, leidet jedoch bis heute unter den Folgen. Auf einer Gedenkfeier forderte er mehr staatliche Unterstützung: „[Wir] wollen […] unsere Würde zurück, Respekt vor unseren Rechten und unseren Schicksalen. Denn für uns Überlebende soll das Leben wieder weitergehen […]. Und dafür brauchen wir Hilfe.“ Erst 40 Jahre nach dem Attentat ließ die Bundesanwaltschaft die Annahme vom suizidalen Einzeltäter fallen und stufte die Tat als rechtsextremistisch ein. Am 3. November 2020 wurde ein Fonds zur Entschädigung der Verletzten und Hinterbliebenen in Höhe von 1,2 Millionen Euro beschlossen. Von den 221 Verletzten lebten zum Zeitpunkt des Beschlusses noch 82 Personen.
Das Foto von 1940 zeigt Reinhard Gehlen in Wehrmachtsuniform vor einer Gruppe deutscher Offiziere und Soldaten. Gehlen war mitverantwortlich für die Logistik des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 1941.
Nach den ersten Niederlagen der Wehrmacht an der Ostfront Ende 1941 wurde Gehlen in deren Geheimdienst beordert. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die militärische Führung mit Informationen über Verfassung und Absichten der sowjetischen Streitkräfte zu versorgen. Im Rahmen seiner Tätigkeiten war Gehlen in die Verbrechen an Juden:Jüdinnen, sowjetischen Kriegsgefangenen und Zivilist:innen verstrickt. Dem Vernichtungskrieg im Osten fielen ca. 30 Millionen Sowjetbürger:innen zum Opfer.
Nach der deutschen Niederlage im Mai 1945 ergab sich Gehlen den Amerikanern. Er ahnte, dass sich die Westalliierten bald gegen die Sowjetunion verbünden würden, und plante, aus der Situation Vorteile zu ziehen. So lagerte er geheimdienstliche Dossiers über die Sowjetunion in Fässern und vergrub diese in Bayern. Sein Kalkül ging auf: Ab 1946 baute er die von den USA finanzierte und nach ihm benannte „Organisation Gehlen“ auf. Reinhard Gehlen arbeitete nicht aus Überzeugung für die Vereinigten Staaten. Vielmehr fand er in seiner Tätigkeit Raum für seine bereits bestehende antikommunistische Haltung und Schutz vor persönlicher Strafverfolgung.
Er war er ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus, Antisemit und Antikommunist. Obwohl der amerikanische Auslandsgeheimdienst mit Gehlen wiederholt unzufrieden war, wurde er 1956 Gründungschef des Bundesnachrichtendienstes (BND). Der BND wurde fast ausschließlich mit seinen „alten Kameraden“ aus der Zeit im Wehrmachtsgeheimdienst besetzt, die ihre Karrieren in der Bundesrepublik in aller Regel unbehelligt fortsetzen konnten und so auch der Strafverfolgung entgingen.
Bei ihrer Gerichtsverhandlung verdeckt Jennifer W. ihr Gesicht mit einem Aktenordner. Am Ende des Prozesses wird sie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassen und Versklavung mit Todesfolge zu zehn Jahren Haft verurteilt.
2014 war Jennifer W. in den Irak gereist, um einen Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu heiraten. Wie viele andere Frauen und Männer hatte sie sich von der Propaganda in den sozialen Medien überzeugen lassen. Die islamistische Propaganda wendet sich insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Teilen der Bevölkerung. Die Islamist:innen sprechen gezielt Menschen ohne Perspektiven oder in Krisensituationen an. So verspricht das Leben im „Kalifat“ des „Islamischen Staates“ Zugehörigkeit zu einer auserwählten Gemeinschaft mit ausschließlichem Wahrheitsanspruch. Auch verheißt die Propaganda die Ausübung von Macht über angeblich wertlose „Ungläubige“. Zudem solle ein gottgefälliges Leben, das streng den Gesetzen der Scharia folgt, dem Alltag seine Ordnung wieder geben.
Für die Rekrutierung weiblicher Personen waren die Frauen des „IS“ zuständig. Diese boten online Hilfe bei der Einreise und beim Finden eines Ehemanns an. Jennifer W. war im Irak als Sittenpolizistin tätig und half unter anderem, die Einhaltung der strengen Verhaltens- und Bekleidungsordnungen für Frauen durchzusetzen. Zusammen mit ihrem Ehemann hielt sie die Jesidin Nora T. und deren Tochter als Sklavinnen. Ihr Ehemann schlug und misshandelte beide regelmäßig. Um das Kind für nächtliches Bettnässen zu bestrafen, fesselte der Islamist das Mädchen und ließ es in der prallen Sonne verdursten. Jennifer W. griff nicht ein und ließ das fünfjährige Kind sterben. Ihr Ehemann wurde, so wie Jennifer W., von einem deutschen Gericht für seine Taten verurteilt.
Im Januar 2023 wurden die Verbrechen des „Islamischen Staats“ an den Jesid:innen vom Bundestag als Völkermord anerkannt.
Am 2. Juni 2019 ermordete ein – polizeibekannter und in Hessens Neonaziszene vernetzter – Rechtsradikaler den hessischen CDU-Politiker und Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der sich seit langem für Menschenrechte und Demokratie engagiert hatte.
Seit Walter Lübcke sich zur Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland bekannt hatte, wurde online gegen ihn gehetzt. Überregional wurde er bekannt, weil der Neonazi M. ein Video im Internet veröffentlichte. So wurde Lübcke zum Feindbild der rechtsextremen Szene. Der Film zeigt einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz des Politikers bei einer Bürger:innenversammlung. Darin äußerte Lübcke, dass es sich lohne, in Deutschland zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten – und wer diese Werte nicht vertrete, habe die Freiheit, das Land zu verlassen. Daraufhin postete sein späterer Mörder E. Drohungen und Hasskommentare gegen Walter Lübcke. Im Zuge der Mordermittlungen konnte eine „Feindesliste“ des Täters sichergestellt werden. Hierauf waren unter anderem Lokalpolitiker:innen, Journalist:innen und Mitglieder der jüdischen Gemeinde Kassels verzeichnet.
M. hatte dem Täter S. die für den Mord bestimmte Waffe beschafft. Am Abend seines Todes trat Walter Lübcke zum Rauchen auf die Veranda seines Wohnhauses, wo er mit einem Kopfschuss hingerichtet wurde. Ob M. zur Tatzeit ebenfalls am Tatort war, konnte nicht aufgeklärt werden. Der Mörder war wegen rassistischer Taten bereits polizeibekannt und verurteilt. Angeblich hatte er sich vor einigen Jahren aus der aktiven Neonaziszene zurückgezogen. Allerdings trainierte er genau wie M. in einem Schützenverein den Umgang mit Waffen.
Für den Mord an Walter Lübcke wurde der Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. M. wurde vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Die Frage nach etwaigen Unterstützer:innen des Täters wurde bis heute nicht aufgeklärt. Durch Taten wie die Ermordung Walter Lübckes versuchen Rechtsterroristen, ein Klima der Angst zu erzeugen, mit dem unter anderem Politiker:innen und Journalist:innen eingeschüchtert werden sollen.
Die 92-jährige Zilli Schmidt, geb. Reichmann, zeigt im Jahr 2016 ihre Häftlingsnummer, die ihr die SS im März 1943 in Auschwitz tätowiert hatte. Das „Z“ steht für die diskriminierende Bezeichnung für Sinti:zze und Rom:nja, die im nationalsozialistischen Deutschland systematisch ausgeschlossen, erfasst, deportiert und ermordet wurden.
Um der Verfolgung zu entgehen, zog Zilli Reichmanns Familie 1938 von Thüringen in das damals gerade besetzte Grenzgebiet der heutigen Tschechischen Republik. 1940 floh die Familie dann ins deutsch besetzte Frankreich. Ihr Vater hatte die Hoffnung, in dem Land als Minderheit der Sinti:zze nicht verfolgt zu werden, auch weil der Sohn mit der Wehrmacht dort stationiert war. Dennoch wurde die gesamte Familie nach Auschwitz deportiert.
Am 2. August 1944 wurde Reichmann aus Auschwitz zur Zwangsarbeit ins KZ Ravensbrück deportiert. Ihre vierjährige Tochter wurde mit der restlichen Familie am selben Tag in Auschwitz-Birkenau ermordet. 1950 stellte sie beim Bayerischen Landesentschädigungsamt einen Antrag auf „Entschädigungszahlungen“. Sie war – wie sie sagte – „sprachlos“, als sie dort Personen wiedertraf, die an ihr „rassenbiologische Untersuchungen“ durchgeführt hatten. Diesen Untersuchungen mussten sich alle Sinti:zze und Rom:nja im Nationalsozialismus unterziehen.
Von den Nationalsozialist:innen aus politischen, religiösen, sozialen, weltanschaulichen oder „Gründen der Rasse“ Verfolgte konnten Entschädigungszahlungen beantragen. Sinti:zze und Rom:nja fielen oft nicht darunter, mit der Begründung, sie seien als „Kriminelle“ oder „Arbeitsscheue“ verfolgt worden, nicht aus „Gründen der Rasse”. Diese Argumentation wurde 1956 durch den Bundesgerichtshof bestätigt, der somit die rassistische Erzählung über Sinti:zze und Rom:nja fortschrieb. Auch Zilli Schmidts Antrag wurde 1953 zunächst abgelehnt. Sie klagte über viele Jahre hinweg und erhielt schließlich eine Teilentschädigung. Für die Ermordung ihrer Tochter wurde ihr bis zu ihrem Tod 2022 keine Entschädigung zugesprochen. Dazu sagte sie 2016: „Deutsche durften Gretel umbringen, aber für eine Entschädigung waren sie nicht zuständig.“
Das Mahnmal vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München erinnert an die neun Opfer des Anschlags vom 22. Juli 2016. An diesem Tag wurden Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano-Josef Kollman, Hüseyin Dayıcık, Janos Roberto Rafael, Selçuk Kılıç, Sevda Dağ und Sabina S. ermordet.
Nach seinen Morden tötete der 18-jährige Deutsch-Iraner sich selbst. Über die Einordnung des Attentats wurde lange debattiert: War es die Tat eines psychisch kranken Menschen oder ein politisch motivierter Terrorakt? Es bedurfte mehrerer Jahre und Gutachten, ehe die Mordabsicht und die rechtsextreme, rassistische Gesinnung des Täters festgestellt wurden.
Der Täter zeigte öffentlich den Hitlergruß und empfand Bewunderung für den rechtsterroristischen Massenmörder, der am 22. Juli 2011 im norwegischen Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet hatte. Diese rechtsterroristischen Gewaltakte, wie auch der in Christchurch 2019, reihen sich ein in eine lange Kette von Anschlägen, die aufeinander Bezug nahmen und die gleiche Ideologie der Menschenfeindlichkeit verfolgten.
Alle genannten Täter nutzten die gleiche Tatwaffe. Wie auch der Attentäter von Christchurch streamte der 18-Jährige seine Tat live ins Internet. Die Gleichgesinnten bestärken einander in ihrem Wahn von der „Überlegenheit der weißen Rasse“. Sie handeln nicht isoliert voneinander, sind Teil eines weltumspannenden Netzwerks und erhoffen sich Ruhm durch ihre Taten. Der Mörder von Christchurch spendete mehrere Tausend Euro an die „Identitäre Bewegung“ in Frankreich und Österreich. Auch in Deutschland ist die rechtsextreme Jugendbewegung seit Jahren aktiv. Ihre Anhänger:innen tragen dazu bei, rassistische Erzählungen gesellschaftsfähig zu machen und haben einen wesentlichen Einfluss auf die Radikalisierung der AfD.
Rechtsterrorismus wendet sich nicht nur gegen die Ermordeten, die wie in München aus deutschen Sintifamilien und Familien mit Einwanderungsgeschichte stammen, sondern gegen die Fundamente der Demokratie. Opferinitiativen fordern an die Namen der Ermordeten zu erinnern. Zudem solidarisieren sie sich mit den Opfern und Angehörigen anderer rechtsterroristischer Anschläge, um auf die andauernde Bedrohung rechter Gewalt in Deutschland aufmerksam zu machen.
Am 8. März 2022 säumten 139 rote Regenschirme die Stuttgarter Innenstadt, getragen von 139 Frauen in schwarzer Kleidung. Mit dieser Aktion wiesen sie am Internationalen Frauentag auf die im Jahr 2020 begangenen Femizide in Deutschland hin. 139 Frauen wurden in dem Jahr von ihren Partnern, Ehemännern, Ex-Partnern oder Ex-Ehemännern getötet – die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen. Die Farbe der Regenschirme symbolisiert die Farbe des Bluts, die schwarze Kleidung trugen sie als Ausdruck ihrer Trauer.
Häufig geschehen Femizide nicht plötzlich, sondern sind der Gipfel einer längeren Vorgeschichte von Gewalt in Beziehungen. So auch bei Eva H.: nachdem sie schwanger wurde, begann die Gewalt. Ihr Partner schlug sie, bald folgten Tritte, auch in den Bauch. Sie suchte Hilfe bei einer Frauenberatungsstelle und begann eine Therapie. Sie trennte sich von ihrem gewalttätigen Freund. Dieser verfolgte sie und lauerte ihr auf. Er schickte ihr Morddrohungen, die sie bei der Polizei anzeigte. Trotz einer Gewaltschutzverfügung hörte er nicht auf, ihr nachzustellen. Laut der Polizei war das nicht ausreichend für einen Haftbefehl, diese versuchte gar nicht erst einen bei der Staatsanwaltschaft zu erwirken. Als sie im sechsten Monat schwanger war, fand ihre erwachsene Tochter sie tot in ihrer Wohnung auf. Ihr Ex-Freund hatte sich als Postbote verkleidet, verschaffte sich so Zugang zur Wohnung und tötete Eva H.
Der Täter wurde wegen Mordes schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe. Eine Verurteilung wegen Mordes stellt in solchen Fällen jedoch die Ausnahme dar. Täter erhalten oft nur milde Strafen und werden lediglich wegen Totschlags oder Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.
Sowohl in den Medien als auch seitens der Justiz und Behörden werden Morde an Frauen bis heute oft als „Beziehungstaten“ charakterisiert. Damit wird ihnen häufig die spezifisch frauenfeindliche Motivation abgesprochen. Häufig ist in Zeitungen auch von einem „Familiendrama“ zu lesen. Solche verharmlosenden Umschreibungen führen dazu, dass von der Sichtbarkeit geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen abgelenkt wird. Jede dritte Frau erlebt in Laufe ihres Lebens Gewalt in Beziehungen. Laut einer 2023 veröffentlichten Befragung findet es jeder dritte Mann in Ordnung, wenn ihm im Streit mit der Partnerin gelegentlich „die Hand ausrutscht“.
Erkennen wir Rassismus?
Sind wir blind gegenüber Rassismus?
Was macht autoritäres Denken so attraktiv?
Wem nützen Ideologien der Ungleichwertigkeit?
Wann ist Geschichte Geschichte?
Wo ist die Grenze unseres Mitgefühls?
Tragen Nazis Springerstiefel?
Wer gehört dazu?
Wer gehört nicht dazu?
Wie sieht Antisemitismus heute aus?
Hören wir den Betroffenen zu?
Warum ist Aufarbeitung notwendig?
Warum geht uns das heute noch an?